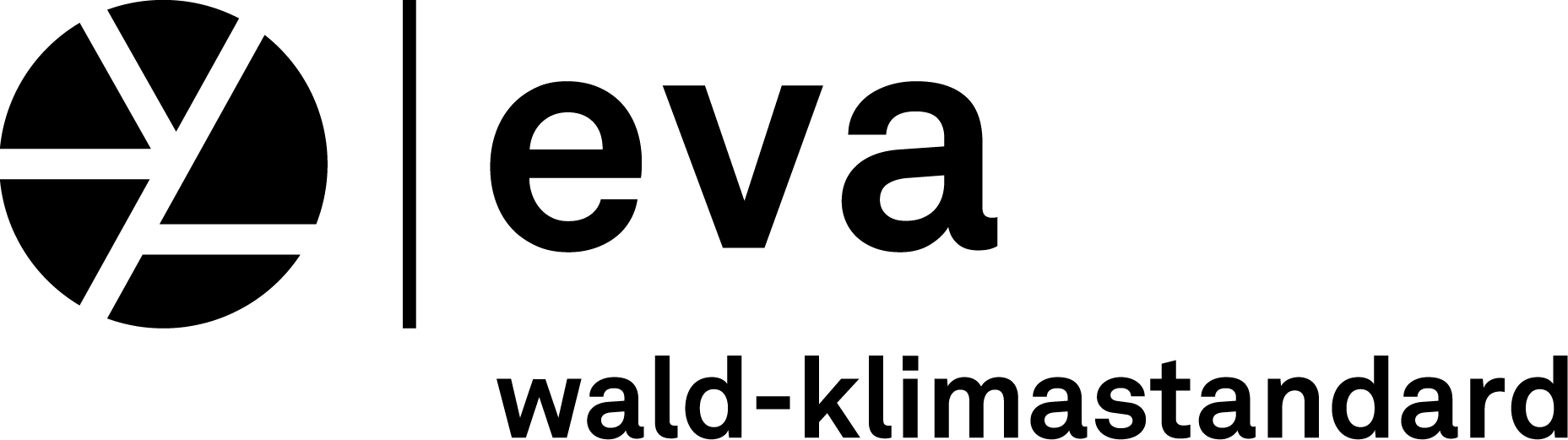Der Wald-Klimarat tagte bereits in fünf Konferenzen über die Entwicklung des Wald-Klimastandards. Der letzte Diskurs rund um Ökosystemleistungen fand auf der Wald-Klimakonferenz im Juni 2023 in Berlin statt. Alle Nachberichte finden Sie hier. Für Rückfragen wenden Sie sich gerne an presse@ecosystemvalue.org
Zuvor fanden im September und Dezember 2021 die ersten beiden Konferenzen aufgrund der Pandemie digital statt. Die 3. Konferenz im März 2022 konnte dann endlich physisch in Berlin stattfinden. Im Oktober 2022 fand in Blankenburg die 4. Konferenz des Wald-Klimarates über zwei Tage statt.
Alle Konferenzen in der Übersicht
Pioniere für den Wald! 5. Konferenz zeigt den Wald-Klimastandard auf dem Weg zur Marktreife.
Am 22. Juni 2023 lud die Ecosystem Value Association zur Wald-Klimakonferenz nach Berlin in die Neue Mälzerei ein. Der Einladung zur Konferenz und dem anschließenden Empfang am Abend in der Wartehalle folgten mehr als 130 Gäste.
Unter den Gästen waren die Mitglieder des Wald-Klimarates und des Technischen Komitees, die Pilotpartner der Methode Wald-Wiederaufbau, sowie Gäste aus Politik, Markt, Forst und zahlreiche Netzwerkpartner.
Pilotphase “Wald-Wiederaufbau” ermöglicht praxisgerechte Anpassungen am Wald-Klimastandard
Im Plenum stellte Moriz Vohrer, Technischer Leiter, die inhaltlichen Anpassungen vor, mit denen sich der Wald-Klimastandard (WKS) in der Methode Wald-Wiederaufbau von der Pilotversion v0.4.3 seit dem letzten Treffen in Blankenburg weiterentwickelt hat zum Entwurf 1.0.0 der Vollversion. In den vergangenen neun Monaten wurden insgesamt 79 Anpassungen (vollständige Übersicht hier) vorgenommen, die signifikantesten sind:
Strukturelle Anpassungen:
-
Statt nur von Klimaleistungen zu sprechen, umfasst der Standard nun generell den Begriff der Ökosystemleistung (ÖSL), um Methodenentwicklungen für andere ÖSL zu ermöglichen.
-
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen wurden entsprechend den Anpassungen aktualisiert.
Inhaltliche Anpassungen:
-
Neu ergänzt wurde die Akkreditierungs-Leitlinie, die den Prozess für eine wissenschaftlich fundierte und praxisorientierte Entwicklung für Methoden unter dem WKS definiert.
-
Auf Basis eines Gutachtens wurde der Permanenz-Puffer auf 15% aller erzeugten Zertifikate festgelegt, um die Permanenz für Klimazertifikate aus Wald-Klimaschutzprojekten in Deutschland sicherzustellen.
-
Ein weiterer Meilenstein in der Standard-Entwicklung ist die Erweiterung des Anwendungsbereiches des WKS um die Methode Waldumbau. Die Methode Waldumbau wird von eva zusammen mit dem Wald-Klimarat und Pina Earth entwickelt.
Finetuning aus der praktischen Erprobung während der Pilotphase:
-
Kalibrierung der Baseline-Modellierung, in der auf Basis verschiedener Input-Parameter wie bspw. Wilddruck, Klimaresilienz der Baumarten, Stärke der Konkurrenzvegetation, etc. die Entwicklung der Naturverjüngung ohne den Einfluss des Menschen modelliert wird
-
Durch die Beantwortung von Klärungsfragen werden einzelne Indikatoren in ihren Details interpretiert. Insgesamt wurden während der Audits der Pilotprojekte 12 Klärungsfragen von Zertifizierern beantwortet. Mit Hilfe dieser Klärungsfragen konnten die Indikatoren konkretisiert werden, was ein effizientes Audit für Projekte nach der Pilotphase ermöglicht.
-
Für die Wahl der waldbaulichen Entwicklungstypen (WET) sind nun auch Mischungen verschiedener WETs erlaubt. Hierbei sind der Standort und das Verhältnis von Laub- zu Nadelbestockung zu beachten, auch innovative Baumarten sind fortan möglich.

Wald-Klimastandard geht mit der Version 1.0 als Entwurf in die Public Consulation
Mit der Vorstellung auf der Wald-Klimakonferenz öffnet eva den Entwurf v1.0 in einer öffentlichen Konsultation der interessierten Öffentlichkeit: Dieser Standard bildet die Grundlage für verschiedene Methoden, die der Akkreditierungs-Leitlinie von eva folgen, insbesondere der Methoden Wald-Wiederaufbau und Waldumbau. Vom 26. Juni bis zum 24. Juli 2023 war der Standard für die öffentliche Konsultation geöffnet.
Mit dieser öffentlichen Konsultation stellt eva auch die Akkreditierungs-Leitlinie vor: Methoden werden nach einem standardisierten Prozess entlang dieser Leitlinie entworfen, um deren Qualität zu gewährleisten. Sowohl die bereits bestehende Methode Wald-Wiederaufbau als auch die derzeit zusammen mit Pina Earth und dem Wald-Klimarat in der Entwicklung befindlichen Methode Waldumbau folgen der Akkreditierungs-Leitlinie von eva.
Die Methode Waldumbau umfasst den Umbau von Reinbeständen zu strukturdiversen Mischwäldern. Im Herbst ist gemäß der Leitlinie ein Qualitätscheck angestrebt, damit nach Zulassung im Technischen Komitee bestenfalls im Spätherbst mit einer Pilotphase für diese Methode begonnen werden kann.
“Versuch macht klug” – sowohl der Standard als auch die Online-Plattformen halten dem Praxistest stand
Verantwortlich für die erste Pilotphase zeichnet Rüdiger Meyer, der einen Einblick in die Lernerfolge gibt: “In der Pilotphase ging es uns noch nicht darum, viele Zertifikate zu erzeugen, sondern wir wollten Technik und Prozess einem Realitätscheck unterziehen – das ist uns gelungen und wir konnten die erforderlichen Anpassungen umsetzen.” Derzeit werden noch bis Herbst 2023 die offenen Projekte aus der Pilotphase zertifiziert, sodass insgesamt mit ca. 75.000 eva-Zertifikaten aus dieser Anfangsphase zu rechnen ist. Die Projekte bilden dabei alle unterschiedlichen Besitzarten in fast allen Bundesländern ab.
In einer Podiumsdiskussion teilten die Pilotpartner Jan Müller-Thomsen von der Oldershausen HOFOS GmbH und Christian Stuhlmann von der Waldkonzepte PartG als erste Anwender, sowie der für die Pilotphase verantwortliche Zertifizierer, TÜV Nord, vertreten durch Carl-Luis Weiss, ihre Erfahrungen.
Christian Stuhlmann, der die Pilotphase von der ersten Stunde begleitet hat, ist mit der Nutzerfreundlichkeit der Plattform zufrieden und nimmt zukünftigen Anwendern die Scheu: “Die dynamische Entwicklung der Plattform ist toll gewesen – das war ja auch Anspruch an diese Phase. Eventuell wird nicht jeder die Plattform sofort bedienen können, dafür braucht es ein gewisses Vorwissen. Aber für diesen Fall gibt es z.B. forstliche Dienstleister, die als Projektverantwortliche eingesetzt werden können und z.B. kleinere Privatwaldbesitzer tatkräftig unterstützen können.”
Jan Müller-Thomsen, der das Pilotprojekt als Nachfolger von Dirk Neuenstein übernahm, betonte die Unterstützung durch das eva-Projektteam: “Ich verstehe mich als digital native und bin gut mit dem logischen Aufbau der Plattform zurecht gekommen. Teilweise liefen Prozesse wie Uploads nicht reibungslos, aber das war bei einer neu entwickelten Technik erwartbar. Dafür stand dann das eva-Team mit Rat und Tat zur Seite und hat auch Vorschläge für die Ausgestaltung der Plattform entgegengenommen und umgesetzt.”
Den Vorteil des digitalen Zertifizierungsprozesses lobt auch Carl-Luis Weiss: “Für mich als Zertifizierer ist die digitale Zertifizierung ein riesiger Schritt nach vorn. Die Zertifizierung wird am Rechner durchgeführt und abgeschlossen, es ist kein gesonderter Bericht erforderlich. Außerdem habe ich für alle meine Eingaben immer direkt den passenden Auszug aus dem Standard bereit. Und: Die Offline-Funktion der Plattform ist natürlich ein großer Vorteil für das Audit auf der Projektfläche.” Für ein reibungsloses Audit gibt er den Anwendern mit: “Bereitet die Audits sauber vor, liefert am Anfang so viele Informationen wie möglich mit – dann läuft das Audit zügig durch.”
Wie wertvoll die Pilotphase und das Engagement der Pilotpartner und des TÜVs waren, fasst Rüdiger Meyer zusammen: “Dass in der Pilotphase alle so konstruktiv aber auch konsequent dran geblieben sind, ermöglicht es uns, ein hochwertiges Produkt zu entwickeln. Und das ist die Voraussetzung, um am Markt zu bestehen. Das Engagement aller Beteiligten geht weit über das reguläre Betätigungsfeld hinaus: Ohne diesen Einsatz wären wir mit eva und dem Wald-Klimastandard nicht so weit wie wir es jetzt sind.”

“Mit hochwertigen Zertifikaten für den freiwilligen Markt adressiert eva das hohe Käuferinteresse an einem Produkt aus Deutschland.”
In einem Update zum Bereich Markt gibt Rüdiger Meyer einen Einblick in den freiwilligen Kohlenstoffmarkt in Deutschland und stellt die Kaufmotivation von Unternehmen für eva-Zertifikate dar.
Eine Podiumsdiskussion mit Helena Scholz, Climate Partner, und Rudolf Maier, Callirius AG, unterstreicht die Relevanz und den Bedarf an hochwertigen und exklusiven eva-Zertifikaten als Bestandteil von Zertifikatportfolios. Rudolf Maier betont das Umdenken der Käufer: “Mit der aktuellen kritischen Berichterstattung sind Unternehmen vorsichtiger geworden und es werden verstärkt regionale Projekte gesucht. Auf diesen Bedarf antwortet der lokale Wald-Klimastandard mit seinen kleinen, scharf regionalbezogenen Projekten. Dabei geht es den Unternehmen nicht mehr nur um die Tonne CO2, sondern um alle Co-Benefits: Die Unternehmen machen sich mehr Gedanken.” Den Aspekt der regionalen Nachvollziehbarkeit der Zertifikate ergänzt Helena Scholz: “Treiber ist sowohl der direkte Bezug zu den regionalen Projekten, als auch die Emotion – die hängt in den DACH-Ländern besonders am Wald: Unternehmen möchten regional einen Impact erzeugen und der Natur vor Ort etwas zurückgeben. Dieses Engagement kann den Kunden anschließend transparent und detailliert aufgezeigt werden.”
Für die nahe Zukunft sieht Rüdiger Meyer Möglichkeiten, mit eva Projektentwickler und CO2-Händler bei der Vermarktung von Projekten zu unterstützen: “Wir sind bereit das eva Impact Registry mit weiteren Features für eine werbewirksame Vermarktung auszustatten und wir bereiten unterstützendes Infomaterial vor. Und natürlich bieten wir an, Verkaufsgespräche mit Unternehmen zu begleiten.”

Fachlicher Austausch auf Augenhöhe in drei Workshops
Am Nachmittag diskutierten die Gäste in zwei Workshop-Sessions den aktuellen Entwurf v1.0 des Wald-Klimastandards, zusammen mit Pina Earth die Methode Waldumbau und blickten mit dem Projektteam von eva tief in den eva-Zertifizierungsprozess auf der Plattform.

Die Konferenz des Wald-Klimarates öffnet sich zur “Wald-Klimakonferenz”
Schon im Rahmen der 5. Konferenz des Wald-Klimarates in Blankenburg im Oktober 2022, hat die Ecosystem Value Association ihr Format bewusst für einen größeren Teilnehmerkreis geöffnet. Ziel ist, alle Akteure des sich entwickelnden Ökosystemleistungsmarktes in Deutschland zusammenzubringen.
Mit der Umbenennung in Berlin am 22. Juni 2023 von der “Konferenz des Wald-Klimarates” in die “Wald-Klimakonferenz” unterstreicht eva diese Ausrichtung. Am Abend fanden sich beim Empfang anlässlich der Wald-Klimakonferenz zahlreiche Gäste aus Politik, Markt und Forst ein, um mit dem Wald-Klimarat und dem eva-Team in den Austausch zu gehen.
Alexander Zeihe, Sprecher des Vorstands der Ecosystem Value Association, dankte den Mitgliedern des Wald-Klimarates, dem Technischen Komitee und allen Netzwerkpartnern für das ausdauernde, konstruktive und bereichernde Engagement.
Startschuss für die Pilotphase
Mehr als 80 Teilnehmende aus dem Wald-Klimarat und dem Kreis der Pilotprojekte folgten der Einladung des Ecosystem Value Association e.V. (eva) am 17. und 18. Oktober 2022 in den Ostharz auf Schloss Blankenburg. Nach einer Waldexkursion informierten sich die eingebundenen Stakeholdergruppen über den Entwicklungsstand des Wald-Klimastandards. Nach drei intensiven Workshop-Runden fiel schließlich der Startschuss für die Erprobung des Standards:
Begleitet vom TÜV, werden im November 10 bis 15 Pilotprojekte in Deutschland eine Zertifizierung durchlaufen. eva-Zertifikate aus Wiederaufforstung können somit erstmals im Dezember an die beteiligten Waldbesitzer ausgegeben, in die eva Impact Registry aufgenommen und im freiwilligen Markt gehandelt werden. Die finale Fassung des ersten deutschen Wald-Klimastandards (Version 1.0) wird eva im Sommer 2023 vorstellen.
Aktuell steht eva in Kontakt mit 39 Organisationen in zwölf Bundesländern, die eine Wiederaufforstung nach dem Wald-Klimastandard durchführen oder planen. Sie repräsentieren alle Waldbesitzarten: Privatwald (18) und Forstbetriebsgemeinschaften (5), Kommunal- (9) und Körperschaftswald (3), Staatswald (3) und Bundesforst. Zwei weitere Betriebe führen Gespräche mit eva über die Teilnahme an der Pilotphase für den Scope Waldumbau, die voraussichtlich im Frühjahr 2023 starten wird.
Ein Update zum Wald-Klimastandard und dem Ablauf der Pilotphase gab Moriz Vohrer, Technischer Leiter des Sekretariats. Ergänzend dazu teilten vier Pilotprojektpartner mit den Konferenzgästen ihre bisherigen Erfahrungen. Den Anfang machte die Stadt Wernigerode mit einer Exkursion am ersten Konferenztag. Michael Selmikat, Revierleiter des Stadtforstes, führte in den Teil seines 2.035 Hektar (ha) großen Waldes, der einst aus Fichten bestand. Im April 2022 begann Selmikat mit der Aufforstung von zwei eva-Projekt-Teilflächen. Die Gesamtfläche von knapp 11,7 ha ließ er vorbereiten und mit vielversprechenden Baumarten bepflanzen: Europäische Lärche (50%), Bergahorn (25 %), Hainbuche (10 %) sowie Vogelkirsche und Schwarzerle (je 5 %). An nassen Standorten kamen Roterle und Esche hinzu. Die Baumartenwahl soll in Kombination mit intensiver Jungbestandspflege, Bejagung und Vergrämung pro Hektar rund 283 Tonnen CO2-Äquivalente speichern, somit ca. 203 Tonnen mehr als ein Referenzszenario, welches 80 t pro Hektar speichern würde. Mit der Zertifizierung im Herbst startet die 30-jährige „Crediting-Periode“. Seine Erfahrungen mit dem Wald-Klimastandard in der Praxis beschrieb Selmikat, der 2021 für seine Forstarbeit den Deutschen Waldpreis erhalten hatte, als durchweg positiv.
Ein Highlight des zweiten Konferenztages war die Vorstellung von drei weiteren Pilotprojekten. Henning Bossmann, Forstwirtschaftliche Vereinigung Vogelsberg-Burgwald, Dirk Neuenstein, HOFOS Oldershausen, und Christian Stuhlmann, Partnerschaftsgesellschaft Waldkonzepte (Projekt mit F3 Forest & Farming 4 Future), erläuterten ihre Motivation, den Wald-Klimastandard anzuwenden. Natürlich sollen die Zertifikate den Waldbesitzern zusätzliche Einkommensquellen erschließen. Die Dienstleistung am Ökosystem müsse aber der Grundgedanke sein, nicht der finanzielle Output. Einhellig lobten die Vorreiter das Streben der eva-Gremien – Wald-Klimarat und Technisches Komitee – bezüglich Qualität, Glaubwürdigkeit, Transparenz sowie Kosteneffizienz durch Digitalisierung.
Die Frage aus dem Auditorium, ob die Nachfrage nach hochwertigen Waldzertifikaten „Made in Germany“ in einem längst bestehenden internationalen Markt gegeben sei, beantwortete eva-Geschäftsführer Rüdiger Meyer mit einem klaren Ja. Eine Preisspanne könne zum jetzigen Zeitpunkt nur grob prognostiziert werden, da sich Marktpartnerschaften gerade erst in der Wertschöpfungskette etablieren. eva geht davon aus, dass gerade deutsche Käufer ein sehr großes Interesse an regionalen Klimaschutzprojekten haben. Die Idee der eva-Zertifikate, dem deutschen Wald zu helfen und hierzulande CO2 aus der Luft zu nehmen, sei ein besonderes Alleinstellungsmerkmal der Qualitätszertifikate und ermögliche es, gute Preise zu erzielen.
In drei Workshops ging es fokussiert um letzte Teilaspekte des Wald-Klimastandards. „Finanzielle Additionalität“ ist gegeben, „wenn die Kosten der Wiederbewaldung der Fläche über die Projektlaufzeit die daraus erwachsenden Einnahmen übersteigen“. Spezielle Fragen der Praktikabilität der „eva Online-Plattform“ prüfte der zweite Workshop. Die neue Methode „Waldumbau“ wurde in einem dritten Workshop vorgestellt und bearbeitet. Sie soll in einem Folgetreffen im Dezember beschrieben werden, begleitet von einer Public Consultation.
Ein Fazit und einen Ausblick formulierte Alexander Zeihe, Sprecher des eva-Vorstandes, nach zwei intensiven Tagen. Er dankte für die ebenso engagierte wie qualifizierte Beteiligung aller Stakeholdergruppen im Wald-Klimarat. Diese habe dazu geführt, dass der Standard nun von der theoretischen Entwicklung in die praktische Anwendung gehen kann. Er sicherte zu, alle Erkenntnisse der 4. Konferenz des Wald-Klimarates weiter zu verfolgen, etwa die Frage der Vereinbarkeit mit staatlicher Förderung oder die Herausforderung einer zielgruppengerechten Kommunikation. Als einen Beleg für den Chancenreichtum der Zertifikate wertete er das Engagement wichtiger Marktgestalter im Wald-Klimarat, so neuerdings von Pricewaterhouse Coopers (PwC) an der Seite von Colliers International, Triodos Bank, ClimatePartner, Primaklima e.V. und vielen anderen. Er dankte allen, die die Konferenz ermöglichten – darunter auch dem Oberbürgermeister von Blankenburg, Heiko Breithaupt, der zukünftig den Kommunalwald im Wald-Klimarat vertreten wird, und der Moderatorin Janine Steeger.
Die 5. Konferenz des Wald-Klimarates ist für April/Mai 2023 anberaumt.
Interessierte Waldbesitzer und Projektentwickler wenden sich an das Sekretariat des Wald-Klimastandards: sekretariat@waldklimastandard.de
Hinter den Kulissen der 3. Konferenz des Wald-Klimarates: Die Begeisterung darüber, endlich persönlich aufeinander zugehen und sich live austauschen zu können, war bei allen Mitgliedern deutlich spürbar.
Der Einladung zum Parlamentarischen Abend folgten Bundestagsabgeordnete der regierenden Koalition und der CDU/CSU-Fraktion – in persönlichen Gesprächen konnten wir Einblick in unsere Arbeit geben und aufzeigen, welchen Beitrag der Wald-Klimastandard zu Klimaschutz und Walderhalt leistet.